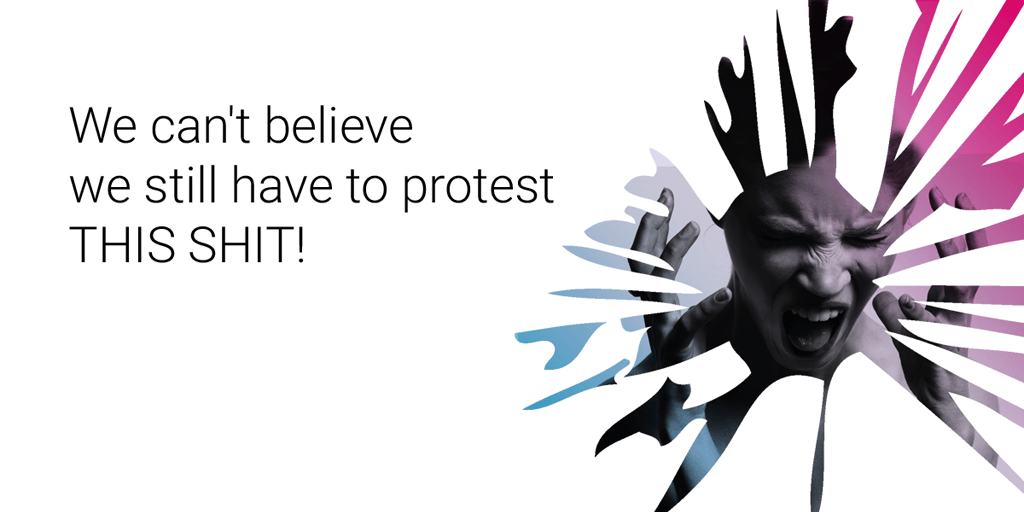Immer wieder flammt in Deutschland die Debatte um das Abtreibungsrecht neu auf. In den vergangenen Monaten ging es dabei vorrangig um die Auseinandersetzung mit dem Paragraphen 219a des Strafgesetzbuchs, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche des „Vermögensvorteils wegen“ verbietet. Bis zur beschlossenen Reform hat er Abtreibungsgegnern ein gelegen kommendes Werkzeug in die Hand gegeben, um selbst Mediziner, die Schwangerschaftsabbrüche lediglich als Teil ihres Leistungsspektrums auf der eigenen Homepage oder Visitenkarte aufführen, wegen des Verstoßes gegen das Gesetz anzuzeigen.
So geschehen im Fall einer Gießener Ärztin, die inzwischen erstinstanzlich zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt wurde. Bundesweit forderten zahlreiche Organisationen und Parteien eine Änderung der Gesetzeslage, um das Recht der Patientinnen auf Information sicherzustellen und Ärzte vor Repressalien zu schützen. Vertreter einer konservativen Politik, unter ihnen der Bundesgesundheitsminister, lehnen entsprechende Bestrebungen wenig überraschend ab. Das traurige Ergebnis ist eine Reform, die kaum jemanden zufriedenstellt und in Augen mancher Kritiker die Situation von Ärzten und Frauen sogar verschlechtert.
Die Debatte über das Abtreibungsrecht auf Paragraph 219a zu beschränken, ignoriert allerdings die Tatsache, dass dies längst nicht der einzige Paragraph zum Thema Schwangerschaftsabbrüche ist, der dringend einer Reform bedarf.
Strafbar? Oder doch nicht? Die aktuelle Gesetzeslage.
Seitdem das Abtreibungsrecht im Jahr 1995 neu geregelt wurde, ist ein Schwangerschaftsabbruch für die meisten Frauen in Deutschland zwar legal möglich, jedoch gilt ein Abbruch nach Paragraph 218 StGB grundsätzlich nach wie vor als Straftatbestand:
„Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. […]“
Unter bestimmten Bedingungen, die im Paragraphen 218a festgehalten sind, gilt der entsprechende Straftatbestand allerdings als „nicht verwirklicht“. Auf diese Weise wird eine Abtreibung legitimiert, sofern die Frauen sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff haben beraten lassen und „seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind“.1
Die „Schwangerschaftskonfliktberatung“ selbst wird im deutlich seltener zitierten Paragraph 219 näher erklärt. Dort heißt es:
„Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. […]“
Es geht hier ausdrücklich nicht um das Wohlergehen, die Interessen oder den Willen der ungewollt schwanger gewordenen Frau. Der Zweck der Beratung ist klar geregelt: Sie soll die Schwangere, unabhängig von deren Bedürfnissen zum Austragen des ungewollten Kindes bewegen. Das „Recht auf Leben“ in „jedem Stadium der Schwangerschaft“ wird nicht begründet, sondern lediglich gesetzt.
Die „zumutbare Opfergrenze“ – eine mehr als fragwürdige Messlatte
Es wirkt mehr als nur ein wenig zynisch, dass einer ungewollt schwanger gewordenen Frau nur dann das Recht zugesprochen wird, die Schwangerschaft zu beenden, wenn „die zumutbare Opfergrenze“ überschritten wird. Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, dass eine ungewollte Schwangerschaft nicht automatisch diese Hürde reißt.
Zum einen ist eine Schwangerschaft eine erhebliche Belastung für den Körper der Betroffenen, sie geht mit Einschränkungen der Lebensführung und nicht zu vernachlässigenden gesundheitlichen Risiken einher. Zum anderen ist das Großziehen eines Kindes, das im Kleinkindalter zwingend auf die ständige Versorgung durch eine Betreuungsperson angewiesen ist, eine Entscheidung, die das Leben der Mutter massiv verändert und durch die zahlreichen Verpflichtungen und finanziellen Belastungen auf Jahre hinaus bestimmt. Die resultierenden Einschränkungen und notwendigen Anpassungen des eigenen Lebensstils, insbesondere für alleinerziehende Mütter oder Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, sind alles andere als unerheblich.
Wer sich dafür entscheidet, ein Kind aufzuziehen, tut dies im Bewusstsein, dass er für dessen körperliches und seelisches Wohlbefinden unmittelbar verantwortlich ist und ihm die Aufgabe obliegt, dem Kind die Pflege, Erziehung und Bildung zukommen zu lassen, die es zur Teilhabe an der Gesellschaft in allen Lebensbereichen befähigen. Elterliche Sorge ist eine umfangreiche Verpflichtung, die nicht staatlich auferlegt werden, sondern ausschließlich freiwillig übernommen werden sollte.2
Die Implikationen des „Rechtes auf Leben“
Mit dem „Recht auf Leben“ erhebt die Formulierung des Paragraphen 219 einen Anspruch im Namen eines Embryos oder Fötus’, der allenfalls das Potenzial zur Menschwerdung besitzt. Um dieses Potenzial entfalten zu können, ist er auf die Zurverfügungstellung des Körpers seiner Mutter angewiesen. Das „Recht auf Leben“ ist damit niemals einfach nur das Recht, zu existieren – es schließt in den ersten Schwangerschaftsmonaten zwingend die Inanspruchnahme des mütterlichen Körpers mit ein. Und es steht in Konflikt mit dem Grundsatz des Strafrechts, dass menschliches Leben mit Beginn der Wehen beginnt.
Das Gesetz besagt nichts anderes, als dass das biologische Zufallsprodukt eines Sexualaktes einen Anspruch darauf hat, von der Besitzerin des Eierstocks, der die betreffende Eizelle beigesteuert hat, fast zehn Monate lang zu zehren, bevor es als Baby auf die Welt kommt. Aber woraus resultiert dieser Anspruch?
Das Gesetz gibt darauf keine Antwort. Eine solche lässt sich in einem religiös-naturalistisch geprägten Weltbild finden, das davon ausgeht, die Vermehrung sei „von Gott gewollt“ und dem Gottgewollten sei unbedingt Folge zu leisten. Die Eizelle hört nach dieser Lesart in dem Moment, in dem sie mit einem Spermium verschmolzen ist und sich in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat, auf, bloßes Zellmaterial zu sein, und wird zum vollwertigen Menschen. Die Schwangerschaft gilt als natürlicher Prozess; ein Abbruch derselben als eine „Straftat gegen das Leben“ – und eben dort ist er in der Rechtsprechung verortet, unter derselben Überschrift wie Mord und Totschlag.
Den Zeitpunkt der Befruchtung einer Eizelle mit der Menschwerdung gleichzusetzen, ist allerdings vom wissenschaftlichen wie vom philosophischen Standpunkt her fragwürdig. Wissenschaftlich ist belegt, dass ein Fötus frühestens ab der ca. 24. Schwangerschaftswoche Schmerz als solchen wahrnehmen kann, da die zu diesem Zeitpunkt beginnende Ausbildung der Großhirnrinde ein Schmerzempfinden überhaupt erst ermöglicht. Von einem „Bewusstsein“, das es dem Ungeborenen erlaubt, Leid oder Angst zu empfinden, kann zu diesem Zeitpunkt der fötalen Entwicklung noch nicht die Rede sein. Entsprechend absurd wirkt die Forderung, dem Fötus, der außerhalb des Mutterleibs nicht überlebensfähig ist, ein Recht auf Leben einzuräumen, vor dem das Recht seiner Mutter auf körperliche und reproduktive Selbstbestimmung zurücktreten muss.
Die gesetzliche Festschreibung der Behauptung, ein Fötus habe gegenüber der Mutter einen Anspruch auf Leben, setzt eine Schwangere, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, grundsätzlich ins Unrecht. Welche psychischen, physischen oder ökonomischen Konsequenzen für Mutter und Kind durch eine ungewollte Schwangerschaft entstehen, gilt dagegen als nachrangig. Das Leben gilt als Wert an sich, seine Qualität interessiert Abtreibungsgegner meist weitaus weniger – deutlich daran zu sehen, dass vor allem die katholische Kirche selbst in Entwicklungsländern mit hoher Kinderarmut und Säuglingssterblichkeit nach wie vor vehement gegen Schwangerschaftsabbrüche zu Felde zieht.
Es ist an der Zeit, das Abtreibungsrecht gründlich zu überarbeiten
Im 21. Jahrhundert ist diese Weltsicht nicht mehr länger vertretbar. Die körperliche und reproduktive Autonomie der Schwangeren ist als ein Grundrecht zu werten, das nicht durch religiöse Befindlichkeiten eingeschränkt werden darf. Eine Einschränkung in Abwägung mit den Rechten des Ungeborenen sollte nur dann erfolgen, wenn es sich bei dem Fötus nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen um ein wahrnehmungs- und empfindungsfähiges Wesen handelt – somit frühestens ab der 24. Schwangerschaftswoche. Bis zur 20. Schwangerschaftswoche muss ein Abbruch daher legal und für jede Schwangere problemlos möglich sein.
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs zu überarbeiten, um nur noch Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe zu stellen, die ohne Indikation nach der 22. SSW durchgeführt werden. Alle anderen Fälle – wie etwa eine Abtreibung gegen den Willen der Betroffenen oder ein Schwangerschaftsabbruch durch dafür nicht qualifizierte Personen oder unter nicht den medizinischen Standards entsprechenden Umständen – können wie andere medizinische Eingriffe auch als eine (ggf. besonders schwere) Form der Körperverletzung behandelt werden und bedürfen keines speziellen Paragraphen.
Eine Änderung des Paragraphen 219 ist ebenfalls notwendig. Wie ein Beratungsgespräch genau aussehen sollte, muss diskutiert werden. Klar ist aber, dass die Pflicht und der Druck Richtung Schwangerschaft unhaltbar sind. Es braucht bei dieser für viele schwierigen Entscheidung gute Betreuung und neutrale Beratung. Es sollte wirklich ergebnisoffen über alle Möglichkeiten informiert werden, die der Schwangeren in dieser Situation zur Verfügung stehen.
Es gibt keine überzeugende Argumentation für Paragraph 219a. Werbung für Schwangerschaftsabbrüche sind über satirische Reaktionen hinaus nicht nur unwahrscheinlich, sondern würden auch ohne den Paragraphen schon Konsequenzen nach sich ziehen. Die Annahme, dass ein Entscheidung für so einen Eingriff durch Werbung beeinflusst werden könnte, ist zudem mehr als fragwürdig. Es braucht hier schlicht keine Sonderregelung. Aber wichtiger noch: Informationen über einen Eingriff sind kein Verbrechen und sollten nicht als solches bestraft werden. Auch die Reform des 219a macht das nicht besser. Stattdessen sollte der Paragraph ersatzlos gestrichen werden.
Alle übrigen Paragraphen des Strafrechts, die sich mit Schwangerschaftsabbrüchen befassen, sind entsprechend anzupassen oder zu streichen.
Diese Überarbeitung des Abtreibungsrechts ist nicht nur längst überfällig, sie ist notwendig, um einer veränderten Wirklichkeit Rechnung zu tragen, in der die Bedingungen, unter denen ein Kind auf die Welt kommt, nicht länger nebensächlich sind. Und sie ist notwendig, um endgültig mit der Vorstellung aufzuräumen, dass eine Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, damit ein Unrecht begeht.
1 Medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche bleiben davon unbenommen, sie sind auch zu einem späteren Zeitpunkt straffrei möglich.
2 In diesem Zusammenhang erfolgt von Abtreibungsgegnern häufig der Verweis darauf, eine Schwangere könne ihr Kind austragen und zur Adoption freigeben. Dies ändert allerdings nichts an den gesundheitlichen Risiken einer Schwangerschaft. Es erhöht darüber hinaus den psychischen Druck, der auf der Schwangeren lastet, und setzt zu großen Teilen darauf, dass diese ihre Meinung während der Schwangerschaft eine Bindung zum ungeborenen Kind entwickelt. Die organisatorische und finanzielle Belastung, die dem Gemeinwesen durch zehntausende zur Adoption freigegebene Babys entstünde, wird in diesem Zusammenhang dagegen selten bis nie thematisiert.